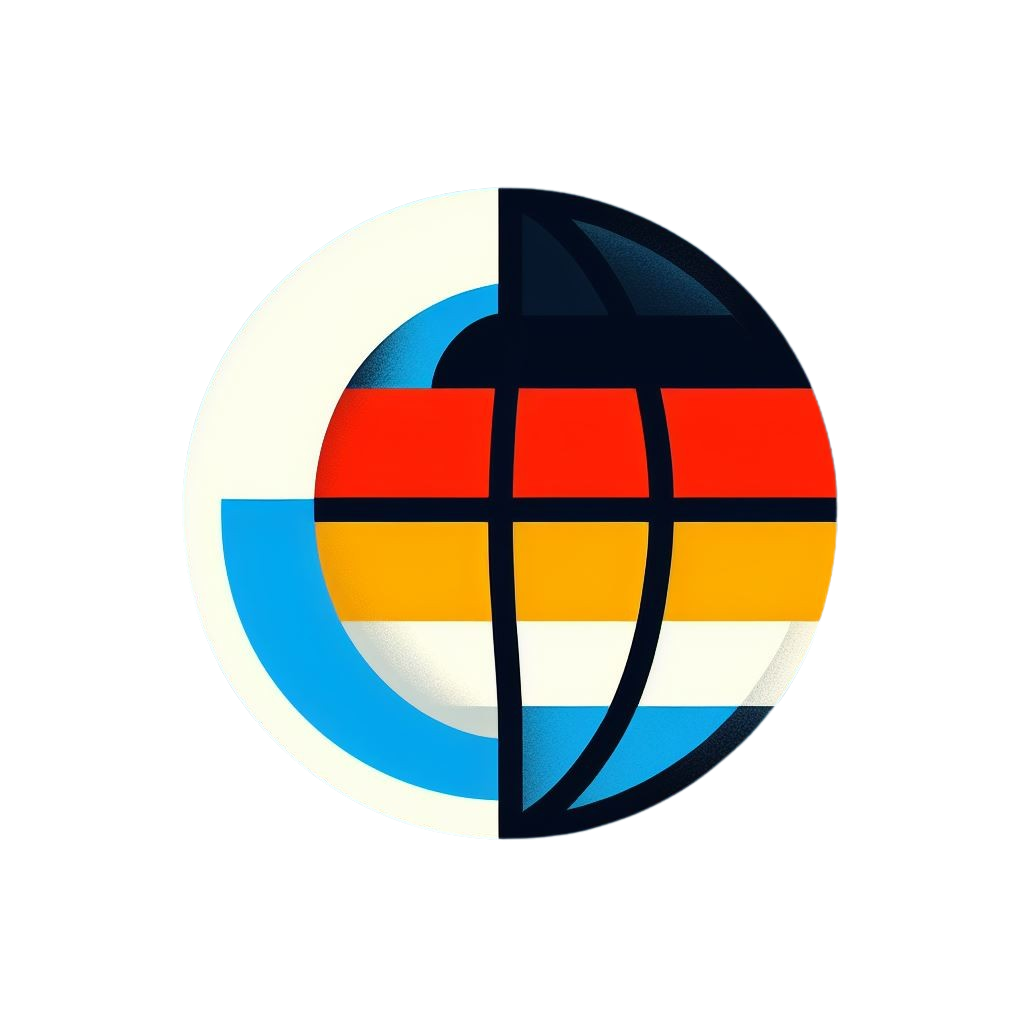Der folgende Text ist eine Buchvorstellung und stellt damit eine meinungsfreie Zusammenfassung des Inhalts dar. Ernstfall für Deutschland
Ein Handbuch gegen den Krieg
Deutschland befindet sich näher am Krieg, als man es sich vorstellen möchte. Warum setzt sich Deutschland dennoch nicht für eine politische Lösung im Russland-Ukraine-Krieg ein? Warum gibt es keine eigenständige deutsche und europäische Sicherheitspolitik? Mit diesen Fragen, Deutschlands Verhältnis zu den USA und der Wichtigkeit eines eigenständigen Europas befasst sich Erich Vad, ehem. Bundeswehrgeneral und Sicherheitsexperte in seinem aktuellen Buch »Ernstfall für Deutschland – Ein Handbuch gegen den Krieg«, erschienen im November 2024 im Westend Verlag.
Das Buch beginnt mit einer dramatischen Beschreibung eines möglichen »Worst Case« für Deutschland im August 2025: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist zu einem europäischen Krieg eskaliert.
Nach über drei Jahren Krieg in der Ukraine, der sich in Deutschland hauptsächlich durch höhere Energie- und Lebensmittelkosten, teils stockende Produktionsketten und Flüchtlingswellen aus dem Kriegsgebiet bemerkbar macht, ändert sich die Situation im Sommer 2025 dramatisch, denn die Bundesregierung hat sich dem Druck der Medien und der NATO, vor allem dem Willen der USA gebeugt und den Taurus-Waffenlieferungen zugestimmt, was die Ukraine vom Verteidigungs- in den Angriffsmodus befördert und sich in der Zerstörung zahlreicher essentieller Ziele auf russischem Territorium manifestiert. Somit wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt und Deutschland rückt als Dreh- und Angelpunkt ins Zentrum des Kriegsgeschehens. Als Schleuse für NATO-Truppenbewegungen der Bündnispartner und aufgrund von Beschuss russischer Ziele durch die in Deutschland stationierten US-amerikanischen Mittelstreckenwaffen konzentrieren sich die Vergeltungsschläge auf die Zerstörung der deutschen Infrastruktur und treffen das Land und seine Bevölkerung mit voller Wucht. Das öffentliche Leben steht still und die Bevölkerung kämpft ums Überleben bzw. befindet sich auf der Flucht.
Die Demokratie erlebt eine »Zwangspause«: die Bevölkerung verliert ihr Mitspracherecht, denn Wahlen werden ausgesetzt, Demonstrationen verboten. Zusätzlich spalten verheerende Propaganda und Desinformation durch russische Medien eine Gesellschaft, die sich am Rand des Bürgerkriegs befindet. Der deutsche Staat bietet keinen Schutz, die Bundeswehr ist weiterhin nicht einsatzfähig, der jahrzehntelange Mangel an Investitionen in Sicherheit und Katastrophenschutz macht sich auf desaströse Art und Weise bemerkbar. Wirtschaft und Gesundheitssystem brechen zusammen, Chaos und Handlungsunfähigkeit bestimmen das Leben. Das transatlantische Bündnis droht zu zerfallen, denn die USA bezeichnen den Krieg gegen Russland als eine »ureigene europäische Angelegenheit« und entziehen sich damit jeglicher weiterer Verantwortung.
Dieses beschriebene Deutschland ist nicht auf den Ernstfall vorbereitet, sondern ging jahrzehntelang davon aus, es wäre ausreichend, »Frieden zu wollen, um ihn zu sichern«. Somit hat es den Schutz in die Hände anderer gelegt und nationale Interessen außer Acht gelassen, anstatt vorausschauend vielseitig vorzusorgen und die eigene Sicherheitspolitik zu stärken.
Erich Vad erörtert in acht Maßnahmen, wie es zu einer solchen Eskalation kommen könnte. Es werden politische Lösungsansätze unterbreitet, um oben beschriebenem oder ähnlich möglichen Horrorszenarien die Realitätsgrundlage zu entziehen.
Erste Maßnahme
Das Problem erkennen: Der (erste) Zug ist abgefahren
Perspektive, Beweggründe und Handlungen sowohl des wohlgesinnten als auch des gegnerischen Gegenübers zu erkennen und zu verstehen ist die Basis für eine Geopolitik, in der bewusste Entscheidungen getroffen werden können. In einer militärischen Pattsituation, die keine Verlierer erlaubt, muss es Verhandlungen geben, wenn jahrelanges Kriegstreiben mit weiteren hunderttausenden Toten und noch mehr Zerstörung und Leid verhindert werden sollen. Die Entscheidungsträger befinden sich aber nicht in Europa, vor allem nicht in der Ukraine, sondern in den USA und in Russland.
Zweite Maßnahme
Tätig werden: Deutschland macht sich kleiner als es ist
Weder Deutschland noch die Europäische Union sind zum jetzigen Zeitpunkt als Global Players etabliert, sie bilden keinen starken Gegenpol zu den vorherrschenden Großmächten. Die geopolitischen Realitäten haben sich verschoben, und neben den vormals Übermächtigen, den USA und Russland, in einem klaren Ost-West-Gefälle, etablieren sich nun die BRICS-Staaten als südlicher Gegenpol und China als aufstrebende Weltmacht, die eine Dominanz im eurasischen Raum für sich beansprucht. Daneben muss sich die EU von dem bisherigen »integrativen Friedensprojekt« emanzipieren und ein stärkeres Zusammenwachsen vorantreiben, um eine wirtschaftliche, politische und militärische Union zu bilden und sich damit als ernst zu nehmendes Gegengewicht in der neuen Weltordnung stark positionieren zu können.
Dafür muss Deutschland als stärkste treibende Wirtschaftskraft innerhalb Europas jedoch die gewohnte Zurückhaltung aufgeben und in die politische Offensive gehen. Es gilt, aktiv und in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Kräften wie Frankreich und Polen und allen anderen globalen Schwergewichten Friedensverhandlungen zu initiieren und den diplomatischen Druck auf Russland zu erhöhen und diesen Krieg, der allen schadet, politisch zu beenden, denn »ohne Frieden wird auf Dauer niemand überleben«.
»Ein Global Player zu sein ist allerdings auch eine Frage des Wollens, nicht nur des Könnens.«
Tercera medida
Wissen, was wir wollen: Ohne Ziel gibt es keinen Weg zum Ziel
Deutschland muss eigene Vorstellungen und Interessen formulieren und verfolgen. Dabei stellt sich die Frage, welche Ziele realistisch und erreichbar sind: Politischer Aktionismus und Symbolwirkung oder lösungsorientierte Verhandlungsstrategien? Eine unabhängige Ukraine?
Welche Gegenleistung gibt es für Russland? Welche Konsequenzen ziehen die Waffenlieferungen nach sich? Wie sieht der Plan für ein Danach aus?
Welche Interessen stehen für Deutschland und Europa über den Krieg hinaus im Vordergrund? Wie sieht Deutschland sein zukünftiges Verhältnis zu den USA, zu China, zum Globalen Süden?
Vierte Maßnahme
Für sich einstehen: Deutschland muss (und darf) sich selbst der Nächste sein
Deutschland und Europa reagieren anstatt zu agieren. Damit positionieren sie sich nicht als »ebenbürtiger Partner« im politischen Weltgeschehen.
Die Bundesrepublik nimmt entgegen ihren Möglichkeiten weder in der EU noch der NATO eine Führungsrolle ein. Die deutsche Zurückhaltung ist selbstfabriziert und wird das Land auf der Weltbühne in Zukunft in eine ständige Nebenrolle zwingen, wenn das Land sich weiterhin hinter anderen versteckt, anstatt die eigenen politischen Interessen offen zu kommunizieren und gegen Widerstände durchzusetzen.
»Politische Lösungen zu finden, entspricht dem Friedensgebot des deutschen Grundgesetzes.«
Fünfte Maßnahme
Abschreckung aufbauen, Verständigung suchen: So sichern Bundeswehr und Politik den Frieden
In der neuen multipolaren Weltordnung muss Deutschland sich behaupten, um nicht Zuschauer des Machtspiels anderer zu werden. Und um sich auf der Weltbühne erneut Geltung zu verschaffen, die eigenen Interessen durchzusetzen und Sicherheit und Freiheit zu erhalten, muss sich das deutsche Denken von dem jahrelang verfolgten »Friedenskonzept« lösen und in eine starke militärische Verteidigungsstrategie wandeln, um einerseits Abschreckung zu demonstrieren und andererseits Partner zu gewinnen.
Der transatlantische Schulterschluss liegt nicht mehr denselben Bedingungen zugrunde wie zu Zeiten des Kalten Krieges und hat sich in Abhängigkeit und Gehorsamkeit Deutschlands den USA gegenüber gewandelt. Die NATO hat sich von einem reinen Verteidigungs- zu einem Zweckbündnis gewandelt, um die Interessen einzelner Mitgliedstaaten durchzusetzen.
Die Rolle Deutschlands im Kalten Krieg war von zentraler Bedeutung, an der direkten Schnittstelle zwischen West und Ost. Und es lag im gemeinsamen Interesse, einen Krieg in Deutschland zu verhindern, der sowohl allen Bündnispartnern als auch den damaligen Ostblock-Staaten »mehr geschadet als genützt« hätte. Deutschland war stets um Abrüstung, Vertrauen und Dialog mit der damaligen Sowjetunion bemüht und damit für die USA ein starker Partner, aber um Frieden und Sicherheit zu erhalten, dürfen »politisches Handeln und Verhandeln, Verständigung und Interessenausgleich« nicht vergessen bzw. ignoriert werden, um »stabile politische Beziehungen in alle Richtungen« zu pflegen.
Sechste Maßnahme
Vorbereitet sein: Bundes-Prepping statt Kampf ums Überleben
Die Antwort auf den Kalten Krieg war eine Friedenspolitik, die mit der Vernachlässigung des Zivil- und Katastrophenschutzes einherging, bspw. im Bau öffentlicher Schutzräume auf Bundesebene sowie in einer abnehmenden Autarkie vom globalen Handel und importierter Sicherung von Grundwaren- und Gütern wie Lebensmitteln und Medikamenten bis hin zur Energieversorgung.
Eine bessere Absicherung des Landes muss jedoch Priorität haben, um Deutschland nicht nur in Friedenszeiten, sondern auch in einem möglichen Kriegsfall unabhängiger zu machen. Es müssen sämtliche Szenarien bedacht werden, auch Ernstfälle und Unvorhersehbares. Und es müssen Entscheidungen getroffen werden.
»Im Kalten Krieg wurde die NATO nicht zweckentfremdet, um die Interessen einzelner Bündnismitglieder durchzusetzen und dafür in den Kampf zu ziehen.«
Siebte Maßnahme
Abnabeln, emanzipieren, selbst denken: Die USA dürfen nicht unser alleiniger Fixstern sein
Warum trägt Deutschland nicht zu einer politischen Lösung im »europäischen Sinne« bei, anstatt in der einseitiger gewordenen deutsch-amerikanischen Allianz mehr und mehr die Interessen der USA zu vertreten? Warum wird kein eigenes Sicherheitskonzept entwickelt, obwohl die Risiken inzwischen den Nutzen für Deutschland in der ungleichwertigen Partnerschaft übersteigen?
Die für 2026 ausschließlich bilateral geplante Stationierung von US-amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland ist in der geopolitischen Situation mit in Kaliningrad stationierten russischen Raketen eine nachvollziehbare Reaktion, um die Abschreckung im NATO-Raum zu erhöhen. Sie birgt jedoch entgegen der von der NATO bestimmten Lasten- und Risikoteilung für Deutschland — als zentraler Dreh- und Angelpunkt — die erhöhte Gefahr eines russischen Vergeltungsschlages direkt auf Deutschland als sogenannten Stellvertreter, sollten die USA einen Angriff auf russisches Territorium von Deutschland aus starten. Dies würde zudem einen neuen Rüstungswettbewerb bis hin zu nuklearer Aufrüstung lostreten und die Hörigkeit den US-Amerikanern gegenüber aktuell betrachtet auf eine ungekannte Spitze treiben. Das Risiko liegt somit allein bei Deutschland. Und gleichzeitig verringern sich Glaubwürdigkeit und Einflussnahme, sollte Deutschland die »notwendige Dialogbereitschaft« für Verhandlungen im Russland-Ukraine-Krieg aufbauen.
Die Lösung kann demnach nur bedeuten, Deutschland endlich zu einem Partner auf Augenhöhe zu entwickeln: Anstatt sie weiterhin »aus den USA zu importieren«, muss es eine Sicherheit made in Germany geben, begleitet von Diplomatie und Dialog, sowie Rüstungskontrolle bis hin zu Abrüstungsmaßnahmen und verstärkte Verfolgung nationaler Interessen.
Achte Maßnahme
Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen: Wenn Dämonen uns hindern, klar zu sehen
Den Feind zu dämonisieren und damit zu entmenschlichen ist eine bekannte Propagandastrategie, um die Gesellschaft durch explizit gewählte Sprache zu beeinflussen und zu verängstigen, damit sich die Menschen mit bestimmten Entscheidungen ihrer Regierung identifizieren und sie somit unterstützen können.
Medien sollten hingegen objektiv informieren, sachgerecht Bericht erstatten und kritisch hinterfragen, um den Menschen die Möglichkeit einer differenzierten Meinungsbildung zu bieten und kritisches Denken anzuregen. Dadurch gestalten sich die Medien glaubwürdig, anstatt nur zu polarisieren. Das führt dazu, dass die Menschen das Vertrauen in die Medien verlieren, was sie folglich zu alternativen und sozialen Informationsquellen treibt. Einerseits besteht dort auch die Möglichkeit, an neutrale Informationen zu gelangen, jedoch birgt es ebenso die Gefahr, politischer Gehirnwäsche unterzogen zu werden.
Um die »große Kluft zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung« zu verringern, müssen sowohl die Medien als auch die Politik als Repräsentanten des Volkes der öffentlichen und vielseitigen Meinung der Menschen mehr Raum und Gehör verleihen und umfangreich und objektiv informieren, um zu erschweren, dass rechts- und linksextreme Kräfte die Medien für ihre Zwecke ausnutzen, um die Bevölkerung zu manipulieren.
»Krieg darf kein Kollateralschaden unserer Außen- und Sicherheitspolitik werden.«
Fazit
Marode Bundeswehr – und damit mangelnde Verteidigungsmöglichkeiten – sowie stagnierendes Wirtschaftswachstum, fehlende Energiepartnerschaften, steigendes Risiko illegaler Einwanderung aufgrund langjährigen Kriegsgeschehens: die Liste der Probleme Deutschlands ist lang. Hinzu kommt das Schwinden der transatlantischen Bindung als Sicherheitsgarant für Europa. Die NATO in ihrer aktuellen Bedeutung muss in Frage gestellt werden. Und Deutschland muss aktiver werden, sich in einem vereinten Europa international wieder als echter Partner auf Augenhöhe präsentieren. Mehr Eigenständigkeit muss demonstriert und eigene Interessen in den Vordergrund gerückt werden.
Deutschland hat seine starke und zentrale Position und damit an geopolitischen Einfluss in Europa und der Welt verloren. Anstatt sich eindeutig zu positionieren und für nationale Interessen einzustehen, hat sich Deutschland von einem einst starken Bündnispartner in einen Untergebenen der USA verwandelt. Um auf die aktuelle Weltlage angemessen reagieren zu können, mangelt es aktuell nicht nur an Realismus und Vernunft, sondern es benötigt auch weit mehr Respekt in der Interaktion, mehr Diplomatie und gegenseitiges Verständnis, trotz unterschiedlicher Wertvorstellungen. Es braucht Kompromiss und Interessenausgleich, um Konflikte zu lösen. Nur aus dem Zusammenspiel von Hard Power – militärischer Stärke – und Soft Power – Dialog und Verständigung – kann Sicherheit nachhaltig gegeben sein.
Das westliche Narrativ einer undifferenzierten Weltaufteilung in Gut und Böse – Demokratien gegen Autokratien – entspricht nicht der vielschichtigen Multipolarität einer sich auflösenden Weltordnung. Eine werte- statt lösungsorientierte Außenpolitik muss man sich leisten können. Und um glaubwürdig zu bleiben, muss sie kontinuierlich umgesetzt werden, ohne dabei die nationalen Interessen zu gefährden. Realistische Ziele und die für die Umsetzung notwendigen Mittel geben einer sicherheitspolitischen Strategie den Rahmen. Sie kann jedoch nur funktionieren, wenn Deutschland die Beziehungen über die USA hinaus stärkt. Das schließt sowohl Russland und China als auch die BRICS-Staaten, den Globalen Süden ein.
»Die Weigerung miteinander zu reden ist das Ende von Politik und Diplomatie.«
Die einzige erstrebenswerte Option für Deutschland ist eine eigenständige Sicherheitspolitik innerhalb einer starken europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion, um für Deutschland und Europa eine Autonomie zwischen den USA, Russland und China zu erreichen und gleichberechtigte Partnerschaften zu schaffen. Das hingegen setzt eine pragmatische und interessenausgleichende Politik sowie konkrete Strategien voraus. Erstarkter geopolitischer Einfluss, bspw. aus der deutschen Wirtschaftsmacht heraus, kann für die Vermittlung in Konflikten zwischen anderen Nationen genutzt werden. Stabile Beziehungen auch zu »schwierigen« Partnern müssen nicht zwangsläufig Abhängigkeit bedeuten.
Die Kernbotschaft des Buches ist eindeutig: Krieg darf niemals die Antwort sein, so unterschiedlich die Interessenlagen und Wertvorstellungen von Nationen auch sein mögen. Deutschlands vorrangige Aufgabe muss immer darin bestehen, innerhalb eines starken und vereinten Europas eine lösungsorientierte Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben und sich für Dialog und Verständigung einzusetzen. Es muss endlich wieder agiert statt reagiert werden. Und es gilt, keine Zeit mehr zu verlieren.
Zum Abschluss möchten wir uns noch bei Herrn Vad bedanken, der uns freundlicherweise die digitale Version seines Buches zur Verfügung gestellt hat.